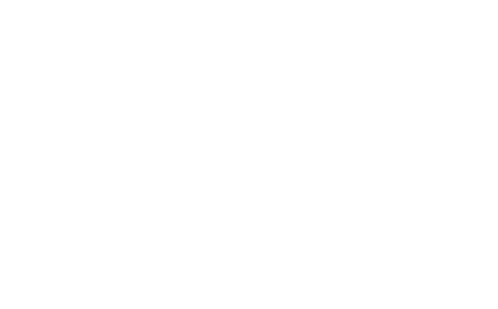von
Rüdiger Landto
ca. 5 Minuten Lesezeit
Resiliente Kommunen: Krisenfest und zukunftsorientiert handeln
Krisen sind längst keine Ausnahme mehr, sondern eine Realität, mit der
Kommunen umgehen müssen. Ob Hochwasser, Extremwetter, wirtschaftliche
Unsicherheiten oder schleichende ökologische Veränderungen – Städte und
Gemeinden stehen vor der Herausforderung, ihre Widerstandsfähigkeit gezielt zu
stärken. Dabei stehen Kommunen vor der doppelten Herausforderung, auf Kriesen
vorbereitet zu sein und gleichzeitig die ambitionierten Klimaschutz- und
Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.
Resilienz bedeutet in diesem Zusammenhang daher mehr als nur
Krisenbewältigung. Sie ist die Fähigkeit einer Kommune, sich an externe
Einflüsse anzupassen, Risiken zu minimieren und durch vorausschauende Planung
die eigene Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. Dabei geht es nicht nur
um Schutzmaßnahmen, sondern auch um eine strategische, nachhaltige
Weiterentwicklung kommunaler Strukturen.
Das Bundeskabinett hat am 6. November 2024 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen, das KRITIS-Dachgesetz, auf den Weg gebracht. Durch das Gesetz soll die entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt werden. Das KRITIS-Dachgesetz verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen, auch Kommunen, zu höherer Resilienz. Kommunen müssen Risiken analysieren, Schutzmaßnahmen umsetzen und Störungen melden. Sie tragen Verantwortung für Daseinsvorsorge, etwa Wasser, Abwasser oder IT. Ziel ist es, die öffentliche Sicherheit und Versorgung im Krisenfall zuverlässig zu gewährleisten.
👉
Zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung.
Resilienz als kommunale Pflicht und Gestaltungsaufgabe
Resilienz lässt sich als Gegenbegriff zur Vulnerabilität verstehen. Während
Vulnerabilität die Anfälligkeit eines Systems beschreibt, zielt Resilienz
darauf ab, Widerstandskraft aufzubauen und Anpassungsfähigkeit zu fördern.
Kommunen, die über resiliente Strukturen verfügen, können Krisen schneller
bewältigen und sind besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.
Dabei gibt es zwei wesentliche Dimensionen von Resilienz:
Einfache Resilienz: Krisen bewältigen und Widerstandskraft stärken
Einfache Resilienz beschreibt die Fähigkeit, unerwartete Krisen schnell zu
überstehen und die gewohnte Funktionsweise einer Kommune rasch
wiederherzustellen. Dabei stehen reaktive Maßnahmen und Schutzmechanismen im
Vordergrund.

Kurzfristige Anpassungsfähigkeit: Kommunale Infrastrukturen
und Verwaltungsprozesse müssen so gestaltet sein, dass sie nach einer Krise
schnell wieder funktionieren. Dies betrifft z. B. den Katastrophenschutz,
die Sicherstellung der Grundversorgung und den Wiederaufbau nach
Naturkatastrophen.
Beispiel: Eine gut organisierte Hochwasserabwehr minimiert Schäden und
ermöglicht eine zügige Rückkehr zur Normalität.

Robustheit und Widerstandsfähigkeit: Kommunale Strukturen
sollten so gestaltet sein, dass sie Krisen besser abfedern können. Dazu
gehören Vielfalt und Redundanz in kritischen Bereichen wie
Energieversorgung, Verkehr oder IT-Infrastruktur.
Beispiel: Die Sicherstellung redundanter Stromquellen durch Photovoltaik und
Batteriespeicher schützt vor großflächigen Stromausfällen.
In dieser ersten Stufe von Resilienz geht es vor allem um die Stabilisierung
und Absicherung bestehender Systeme, um akute Krisensituationen zu meistern.
Reflexive Resilienz: Vorausschauende Planung und systemische Transformation
Während einfache Resilienz darauf abzielt, den Status quo zu bewahren, geht
reflexive Resilienz einen Schritt weiter: Sie setzt auf strategische Anpassung
und langfristige Transformation, um die Widerstandskraft von Kommunen
nachhaltig zu erhöhen.

Strategische Anpassungsfähigkeit: Kommunen müssen in der
Lage sein, sich aktiv auf künftige Krisen vorzubereiten. Dies erfordert eine
langfristige Planung, die sich an zukünftigen Herausforderungen
orientiert.
Beispiel: Klimaanpassungsstrategien, die Hitzeschutzmaßnahmen,
wassersensible Stadtentwicklung und nachhaltige Mobilitätskonzepte
kombinieren.

Systemische Transformationsfähigkeit: Langfristig müssen
Kommunen über reine Anpassung hinausdenken und ihre Strukturen proaktiv
verändern, um Risiken zu reduzieren. Das bedeutet, dass nicht-nachhaltige,
krisenanfällige oder veraltete Praktiken, Technologien oder Strukturen
gezielt aufgegeben werden, um Raum für resiliente, zukunftsfähige
Alternativen zu schaffen.
Echte Transformation nur gelingt, wenn man nicht nur Neues einführt
(Innovation), sondern Altes aktiv abbaut (Exnovation).
Beispiel: Der Umbau des Energieversorgungssystems weg von fossilen
Energieträgern hin zu dezentralen erneuerbaren Energiequellen stärkt sowohl
Klimaschutz als auch Versorgungssicherheit.
Diese zweite Stufe von Resilienz erfordert eine strategische Herangehensweise,
die langfristige Veränderungen ermöglicht und die Weichen für eine nachhaltige
und widerstandsfähige Zukunft stellt.
Vier zentrale Prinzipien resilienter Kommunen
Diese Prinzipien sind wichtig, damit Kommunen besser mit Krisen umgehen und
proaktiv die Anpassung an zukünftige Herausforderungen gestalten können. Um
die Resilienz von Kommunen langfristig zu stärken, sollten diese Prinzipien in
allen kommunalen Strategien berücksichtigt werde.
➡️ Feedback-Loops – Effiziente
Informationsverarbeitung und schnelle Reaktionsfähigkeit Frühzeitige Erkennung
und gezielte Steuerung sind entscheidend für die Krisenbewältigung. Digitale
Informationssysteme ermöglichen es, relevante Daten in Echtzeit zu erfassen
und in Entscheidungsprozesse zu integrieren. Beispiel: Sensorgestützte
Überwachung der Wasserinfrastruktur kann Trinkwasserrisiken frühzeitig
erkennen, sodass präventive Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.
➡️ Modularität – Strukturen
krisensicher und flexibel gestalten Kommunale Infrastrukturen sollten so
aufgebaut sein, dass einzelne Komponenten unabhängig voneinander funktionieren
können. Dadurch lassen sich Störungen gezielt isolieren, ohne das gesamte
System zu gefährden. Beispiel: Eigenständige Energie- und Kommunikationsnetze
sorgen dafür, dass Notfallkommunikation und Strom- und Wasserversorgung auch
im Krisenfall aufrechterhalten bleiben.
➡️ Diversität – Vielseitige
Lösungswege für eine höhere Widerstandsfähigkeit Monostrukturen sind anfällig
für Krisen. Kommunen sollten daher auf eine breite Mischung an Energiequellen,
Wirtschaftszweigen und Mobilitätskonzepten setzen. Beispiel: Eine dezentral
organisierte Energieversorgung mit Photovoltaik, Windkraft und
Batteriespeichern stärkt die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und
reduziert das Risiko von Versorgungsengpässen.
➡️ Redundanz – Kritische
Infrastrukturen mehrfach absichern Wichtige Versorgungsstrukturen sollten
durch alternative Systeme ergänzt werden, um im Krisenfall eine zuverlässige
Grundversorgung sicherzustellen. Beispiel: Notstromaggregate in kommunalen
Einrichtungen, Retentionsflächen für Starkregenereignisse oder redundante IT-
und Kommunikationssysteme verbessern die Krisenresistenz.
Handlungsempfehlungen für kommunale Entscheidungsträger
Resilienzfördernde Maßnahmen sollten systematisch in die kommunale Strategie-
und Investitionsplanung integriert werden. Zentrale Handlungsempfehlungen:
✅ Resilienz als zentrales Querschnittsthema in allen
kommunalen Planungen und Entscheidungsprozessen verankern.
✅ Bestehende Strategien und Konzepte um
resilienzfördernde Maßnahmen ergänzen.
✅
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung fördern, um
Synergieeffekte zu nutzen.
✅ Digitale Technologien gezielt einsetzen, um
Krisenfrüherkennung und Entscheidungsprozesse zu optimieren. (insbesondere in
den Bereichen Energie, Mobilität und Digitalisierung.)
✅
Investitionen in resilienzsteigernde Infrastrukturen
vorantreiben, um langfristige Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
✅ Resilienz als Fähigkeit nutzen, um den notwendigen
Wandel in Richtung Nachhaltigkeit herbeizuführen
Energieversorgung als wichtiger Schlüssel zur kommunalen Resilienz
Eine stabile und nachhaltige Energieversorgung ist essenziell für eine
resiliente Kommune. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) strebt
Deutschland einen Anteil von mindestens 80 % erneuerbarer Energien am
Stromverbrauch bis 2030 an. Kommunen spielen hierbei eine Schlüsselrolle und
können durch gezielte Maßnahmen ihre Energieunabhängigkeit und
Versorgungssicherheit stärken.
Mögliche Maßnahmen:
➡️ Aufbau
Erneuerbarer-Energien-Gemeinschaften zur Nutzung lokaler
Energiequellen.
➡️
Investition in Photovoltaik, Windkraft und Speichertechnologien
zur Sicherstellung der Stromversorgung.
➡️ Blackout-Vorsorgekonzepte für kommunale
Gebäude und kritische Infrastrukturen entwickeln.
Fazit: Resilienz als Zukunftsstrategie für Kommunen
Resiliente Kommunen sind besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.
Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit muss dabei als integraler Bestandteil
der kommunalen Planung verstanden werden. Investitionen in nachhaltige
Energieversorgung, digitale Infrastruktur und modulare Systeme sind
entscheidend, um Städte und Gemeinden zukunftssicher aufzustellen. Kommunale
Entscheidungsträger sind gefordert, resiliente Strukturen zu schaffen – für
eine nachhaltige, sichere und wirtschaftlich stabile Zukunft.
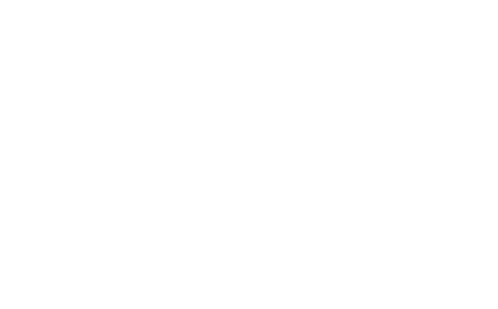
Unser Angebot: Kommunale Resilienz Workshops, Resilienz
Coachings, Ausarbeitung einer Resilienzstrategie für ihre Kommune.